Fluglärm konkret entgegentreten
Pragmatische Lösungsversuche wählen
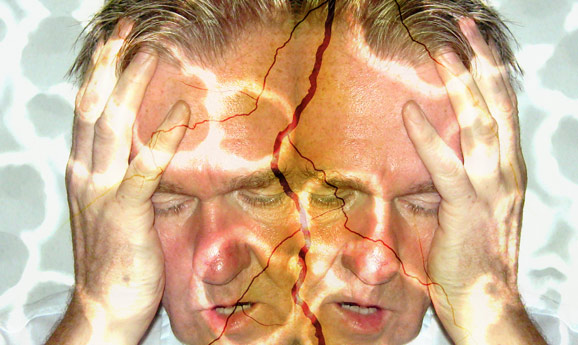
Frankfurt ist weder ein Naturschutzgebiet noch eine Produktionshalle, sondern zuerst die Wohnstätte und Heimat von fast 700.000 Menschen. Zählt man das Umland des Rhein-Main-Gebiets dazu ist man rasch auf der Größe von mehreren Millionen Menschen, die von den Lärmfolgen des Ausbaus des Frankfurter Flughafens betroffen sind.
Ein gewisses Lärmmaß gehört zum menschlichen Leben. Die meisten Menschen möchten kaum stets in völliger Stille leben, ohne die Laute von Tieren, die Rufe der Mitmenschen, das Geknatter der ein oder anderen Apparatur. Zugleich aber will niemand an einer Autobahn oder über einer Anflugschneise leben. Wer anderes behauptet, solle erklären, warum Wohnungen mit Blick auf nahe Schnellstraßen nicht die höchsten Mieten erzielen oder warum selbst die Fraport bereit ist, Häuser in Flörsheim, Raunheim oder Kelsterbach aufzukaufen, weil ein Leben dort kaum mehr unter humanen Bedingungen möglich ist.
Der Mensch braucht also beides: Schall und Stille. Die Industrialisierung seit dem 19. Jahrhundert und die Bestrebungen nach stetem ökonomischem Wachstum haben allerdings auch zu neuen Formen von Lärm geführt. Die Ausweitung von Produktion, Verkehr, Gastro- und Unterhaltungsindustrie führte zu einer Zunahme von Lärm. Reduziert wurde der Lärm für die Stadtbewohner wiederum dadurch, dann man Gewerbe an die städtischen Randlagen verlegte und die Ausweitung des Verkehrs durch leisere Fahrzeugmodelle auszugleichen versuchte.
Dennoch hat sich der Lärmpegel in deutschen Städten in den letzten Jahrzehnten laut Presseangaben merklich erhöht. Die Wochenzeitung „Die Zeit“ schrieb beispielsweise schon 2001, dass sich der Lärmpegel in deutschen Städten in den 15 Jahren von 1976 bis 1991 verdoppelt habe. Zwei Drittel der Deutschen fühlten sich von Straßenlärm, knapp die Hälfte durch Fluglärm und ein Viertel durch Schienenlärm erheblich belästigt. 20% der Bevölkerung gaben an, nachts regelmäßig schlecht zu schlafen, weil es zu laut sei. 3% aller deutschen Herzinfarkte seien auch auf Straßenverkehrslärm zurückführen, und16% aller Deutschen lebten konstant mit einem Lärmpegel, bei dem ein erhöhtes Herzinfarktrisiko festgestellt wurde. Die negativen vegetativen Folgen von Lärm sind nicht von der Hand zu weisen und mehrfach untersucht worden. Und nicht ohne Grund gehört es auch zu den Methoden von Folterkellern, Gefangene gezielt Lärm auszusetzen.
Vor der Herausforderung, Gegenmaßnahmen zur Lärmausweitung zu finden, steht derzeit das gesamte Rhein-Main-Gebiet. Wenn man den Wachstumstrend, das Primat des ökonomischen Denkens, derzeit schon nicht aufhalten kann oder will, dann muss man zumindest die Folgen zu lindern helfen. Andernfalls droht auch eine Zunahme seelischer, körperlicher und psychosozialer Leiden, die mit der Verlärmung einhergehen und wiederum volkswirtschaftliche Kosten nach sich ziehen.
Der Fluglärm ist nur ein Aspekt der Verlärmung. Dennoch ist er ein augenfälliger und entscheidender, seit im Oktober die neue Landebahn Nordwest in Betrieb genommen wurde.
Man wird beobachten müssen, welche Folgen die wirtschaftliche Krise längerfristig auch für den Flugverkehr haben wird. Möglichenfalls lindern sich dadurch manche Lärmprobleme von alleine - ein positiver Nebeneffekt. Kurz- und mittelfristig aber müssen zum Schutz der Einwohner ganz pragmatische Maßnahmen ergriffen und von der Politik durchgesetzt bzw. gefördert werden.
Hierzu gehören kurzfristig, gemäß der Petition „Besserer Schutz der Bevölkerung des Rhein-Main-Gebietes vor Fluglärmbelastung“.
- Eine Neubewertung der Flugrouten für den Flughafen Frankfurt/Main unter besonderer Berücksichtung von Lärmschutzaspekten. Die Flugrouten sollten vorrangig über unbewohntes Gebiet gelegt werden, was zudem auch der Sicherheit der Allgemeinheit im Falle eventueller Abstürze dienlich sein dürfte.
- Festgesetzte Routen dürfen nur aus Sicherheitsgründen verlassen werden
- Umsetzung eines dauerhaften Nachtflugverbotes von 22.00 bis 6.00Uhr
- Schaffung eines nichtverfallbaren Rechtsanspruchs auf passiven Schallschutz in den dafür ausgewiesenen Gebieten und dessen sofortige Umsetzung
- Festlegung zulässiger Pegel für Fluglärm
Zudem sollten folgende mittelfristige Maßnahmen gefördert werden:
- Förderung geräusch- und verbrauchsarmer Flugzeugmodelle. Flugzeughersteller wie Airbus oder Boeing arbeiten bereits intensiv an der Verfeinerung solcher moderner Systeme.
- Entwicklung geräusch- und emissionsärmerer Anflugverfahren. Beispielsweise Wissenschafter der Technischen Hochschule Aachen haben sich bereits mit der Erforschung solch alternativer Flugverhaltens beschäftigt.
- Entwicklung elektrischer Bugradantriebe, mit denen ein Flugzeug ohne Einsatz von Haupttriebwerken und Schleppfahrzeugen vor- und rückwärts rollen kann. Das Flugzeug kann so fast geräuschlos über das Rollfeld gezogen werden, und es lassen sich mehr als 25 Prozent der Emissionen am Flughafen einsparen. Forscher des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt haben sich bereits hiermit beschäftigt.
Marlis Lichtjahr





