Warum ich deutsch bin
Und wieso ich dennoch daran zweifle.
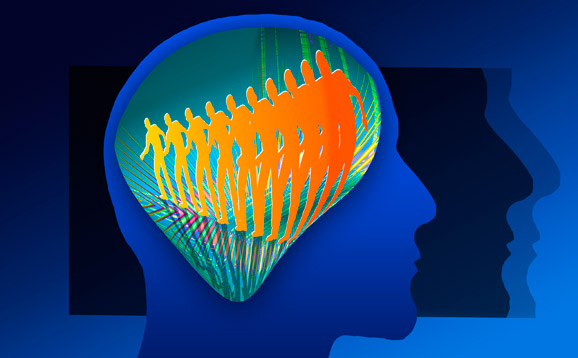
Fast ausschließlich im Mittelpunkt von persönlichen Erfahrungsberichten von Einwanderern und Nachkommen von Einwanderern stehen Menschen aus dem islamischen Kulturkreis. Über ihre Probleme mit Deutschland und der der deutschen Gesellschaft ist viel bekannt, auch die Medien stellen diese Gruppe immer wieder besonders heraus. Aber es gibt auch noch ganz andere Berichte und Erfahrungen aus ganz anderer Perspektive und ganz anderen Motiven. Der Autor des folgenden Textes ist ein junger Frankfurter und Student, der den FREIEN WÄHLERN bekannt ist. Es ist ein wichtiger, bewegender Text.
Wolfgang Hübner
____________________________________________________________________________________
„Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,
Und meine heißen Thränen fließen.“
- Heinrich Heine
Meine Geschichte beginnt im Oberschlesien der frühen 1920er Jahre. Ein Weltkrieg war gerade verloren, bei dem Millionen ihr Leben ließen und ganze Nationen von der Landkarte verschwanden oder wieder auferstanden. Der Versailler Vertrag, von den Alliierten Siegermächten dem Deutschen Reich aufgezwungen, wurde erst vor kurzem unterzeichnet, das Deutsche Reich ging in den Wirren nach dem 1. Weltkrieg in einem Zustand politischer Unsicherheit auf. Im Osten Deutschlands wird mit Polen ein Staat wiedergeboren, der zuvor über mehr als ein Jahrhundert nicht existierte. Oberschlesien ist als eines der wichtigsten Industriezentren Deutschland derweil stark umkämpft. Polnische Nationalisten wollen die Annektion Oberschlesiens an das neu gegründete Polen, Deutsche organisieren sich in Freikorps gegen die so genannten „Schlesischen Aufstände“. Es kommt immer wieder zu Volksabstimmungen, die zu einem Großteil positiv für den Verbleib Oberschlesiens im Deutschen Reich ausgehen.
Dennoch werden Teile Oberschlesiens trotz Abstimmungen an Polen abgetreten. Für die nun in Polen lebenden Deutschen hat dies (wie auch in vielen anderen ehemals deutschen Gebieten) Auswirkungen, die bis heute nachhallen. Es ist der Beginn eines Identitätsproblems, das Menschen wie mir fast 100 Jahre danach immer noch offene Wunden bereitet.
Meine Urgroßeltern, geboren kurz nach der Jahrhundertwende werden nun polnische Staatsbürger oder leben plötzlich in einer Stadt, in der die Grenze mittendurch geht. Die Frage nach ihrer Identität steht noch außer Frage, die Nachbarn sind ja immer noch die Gleichen, und trotz Repressalien geht das Leben weiter. Immerhin wird man nicht aus seiner Heimat vertrieben. Die nächste Generation sollte nicht so viel Glück haben. Meine Großelterngeneration wird kurz nach der Machtergreifung Hitlers geboren. Diejenigen, die nach der Zerstücklung Oberschlesiens in Deutschland verblieben, hatten Glück im Unglück, die anderen erleben eine beispiellose Polonisierung und werden schnell dazu gezwungen, ihr deutsches Erbe aufzugeben. Nur ein paar Jahre später, im Jahr 1939, herrscht für viele eine Situation wie nach dem Fall der Berliner Mauer: Familien, die durch Grenzen getrennt wurden, gehören wieder zum selben Staat und Volk. Die deutschen Soldaten kommen für diese Menschen als Befreier. Was nach dem Krieg mit diesen Menschen geschah, ist allseits bekannt. Nicht so gut bekannt ist das Schicksal derer, die der Vertreibung aus verschiedenen Gründen entgangen sind oder keine Möglichkeit zur Flucht hatten. Besonders in Oberschlesien bildeten diese Menschen keine Minderheit.
Zu diesen Menschen gehörte auch meine Familie. Auch noch lange nach dem Krieg blieben viele deutsche Oberschlesier in ihrer Heimat. Alles Deutsche wurde in dieser Zeit getilgt. Die Sprache verboten, das Brauchtum unterdrückt und ein Bekenntnis zur deutschen Nation zog übelste Konsequenzen mit sich. Trotzdem gründeten im jetzigen Polen viele Deutsche sogar Familien. Man pflegte insgeheim deutsches Brauchtum und die deutsche Sprache, musste nach außen hin aber Konformität mit der neuen Obrigkeit zeigen. Denunziation, Anfeindungen und Benachteiligungen aufgrund der deutschen Herkunft sind an der Tagesordnung. Abfällig wird meine Großmutter „Niemka“ genannt, da ist sie gerade mit meinem Vater schwanger. Mein Vater wird in den 50er Jahren in die denkbar deutschfeindlichste Umgebung geboren, die sich vorstellen lässt.
Obwohl Oberschlesien die geographische Heimat ist, schielt man sehnsüchtig zu Familienangehörigen, die es geschafft haben, sich wenigstens in die DDR zu retten. Denn selbst aus den netten Nachbarn, die einst am eifrigsten den Hitlergruß tätigten, werden nun Denunzianten. Die Situation wird unerträglich und der Schmerz, die Heimat zu verlassen, weicht dem Verlangen, wieder unter seinesgleichen zu sein.
Letztendlich wird dieser Wunsch erfüllt, als meine Großmutter in den späten 60er Jahren nach Deutschland ausreisen darf. Mein Vater kommt einige Jahre später hinterher. Man hofft nun endlich „angekommen“ zu sein – doch die Hoffnung entpuppt sich als zweischneidiges Schwert. Wurde man vor kurzem noch in Polen als Deutscher diskriminiert, so wird man nun in der neuen, alten Heimat als „Pollacke“ beschimpft. Die deutsche Staatbürgerschaft meiner Großmutter musste erst mit aufwendiger Bürokratie und Papierkram „festgestellt“ werden, und meinem Vater, der deutschen Sprache mächtig und gerade mit dem polnischen Abitur fertig geworden, wurde jegliche Bildung abgesprochen. Er musste frisch in Deutschland angekommen, sein Abitur auf Deutsch wiederholen. Aber auch das war kein Hindernis. Als Deutscher akzeptiert wird er trotzdem nicht. Dagegen sprechen sein nicht deutsch klingender Nachname und die Tatsache, dass er in Polen geboren ist. Mein Vater erlebt wie zuvor seine Mutter in Polen viele Anfeindungen und Benachteiligungen, ausgerechnet von dem Volk, nachdem man sich in Schlesien so viele Jahre gesehnt hat.
Es ist wie ein Schlag ins Gesicht. Aber die Freude in Deutschland zu leben überwiegt und meine Familie etablierte sich schnell in der neuen Heimat Frankfurt. Mein Vater studierte und begann seiner Arbeit nachzugehen. Im Urlaub in der schlesischen Heimat lernte er meine Mutter kennen, deren Familie aus Posen stammt. Auch sie haben eine ähnliche Geschichte hinter sich mit dem Unterschied, dass ihre Polonisierung weitgehenst abgeschlossen war. Nur noch die Urgroßeltern sprechen deutsch, die Großeltern gebrochen und die einst deutsche Herkunft der Familie gerät schnell in Vergessenheit. Sie folgt ihm nach Deutschland und erlangt wie üblich nach unzähligen Behördengängen und Papierkram die deutsche Staatsangehörigkeit „ius sanguinis“. Menschen wie meine Familie werden in Deutschland Spätaussiedler genannt.
Mit mir beginnt die erste Generation, die wieder auf deutschem Boden geboren wurde seit 1945. Ich wachse mit Deutsch als Muttersprache auf, weiß aber um meine im heutigen Polen verbliebene Familie. Wenn meine Eltern vor mir was geheim halten wollen, sprechen sie polnisch und merken nicht, dass ich als Kind nach und nach, obwohl ich es nicht sprechen kann, verstehe, was sie sagen.
Bis ich in die Schule kam, war auch noch für mich meine Identität kein Problem. Jeder würde nun vermuten, dass 70 Jahre nach der Teilung Oberschlesiens und 45 Jahre nach Flucht und Vertreibung auch die letzten eine neue Heimat in der Bundesrepublik finden. Aber diese Geschichte soll aufzeigen, dass auch so viele Jahre danach noch längst nicht alle Wunden geheilt sind.
So weit ich an meine Kindheitstage zurückdenken kann, weiß ich wie seltsam relevant der Geburtsort meiner Eltern für die Schulfreunde und deren Eltern war. „Ach, sie kommen also aus Polen?“ war die gängige Frage. Im Kindergarten begriff ich noch nicht, wie ernst für mich einst diese Frage nach der Herkunft werden würde. Erst in meiner Schulzeit wurde mir bewusst, dass ich anscheinend doch nicht Teil des Ganzen bin. Was durch Erziehung und Sozialisation in meiner Familie eigentlich klar war, wurde für mich spätestens in der Grundschule immer unklarer. „Ah, der Pole kommt wieder“ hieß es vor dem Unterricht. Bei Auseinandersetzungen wurde daraus schnell auch mal „du Pollackenschwein!“. Als ich einen Schulfreund besuchte, wurde von seiner Großmutter zuallererst meine Herkunft festgestellt. „Du bist also der Junge, dessen Eltern aus Polen kommen?“. Das Gesicht seiner Großmutter verfinsterte sich. Als ich ihrem Enkel im Laufe des Tages bei seinen Hausaufgaben helfen wollte, wurde ich von seiner Großmutter schroff mit den Worten „Das schafft er sicher auch allein“ abgewiesen, als wolle sie nicht, dass der vermeintlich polnische Junge was besser weiß als ihr Enkel.
Was ich anfänglich ignorierte, wurde mir immer unangenehmer. Zu bestreiten, dass ich ein „Pollacke“ sei, half nichts. Je mehr ich das bestritt, desto mehr wurde ich damit aufgezogen. Auch als ich einige Jahre später erfuhr, dass die Jungs, die am lautesten „Pollacke“ riefen, selber Großeltern aus der Nachbarortschaft meiner Vorfahren hatten, änderte nichts daran, dass in mir eine Unsicherheit wuchs, die ich mit aller Kraft zu kompensieren versuchte. „Ich muss besonders deutsch auftreten, keinen Zweifel an meiner Herkunft aufkommen lassen“, dachte ich mir, und steigerte mich in die Versuche, deutscher zu sein als „die Deutschen“ erfolglos hinein. Der Ruf eilte mir auch im Gymnasium voraus. Ein Junge, der zufällig in die gleiche Klasse kam wie ich, verbreitete schnell die Information, dass ich Pole sei. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir für einen 11-12 jährigen ein recht umfangreiches Wissen über die deutsche Geschichte angeeignet, mit dem ich glaubte, jede Behauptung argumentativ zu widerlegen. Aber egal wie sehr ich mich bemühte mit all meinem erarbeiteten Wissen, meinen unzähligen Gespräche mit meiner Großmutter und allerlei Tricks, die ich mir ausdachte: Selbst für Klassenkameraden die sich als meine Freunde bezeichneten, war ich unanfechtbar „der Pole“. Ausgerechnet ein aus Russland stammender jüdischer Mitschüler der mit ähnlichen Problemen kämpfte, sah mich als das an, was ich war. Er sollte für eine lange Zeit zu einem meiner besten Freunde werden.
Die Jahre auf der Schule vergingen und ich resignierte immer mehr, bis der für mich zum Makel gewordene Begriff „Pole“ mir irgendwann gleichgültig wurde – ich nahm mein Schicksal an. Mein Freundeskreis beschränkte sich zunehmend auf russische, polnische und andere Einwanderer aus den ehemaligen Sowjetstaaten. Ich begann mich selbst zu verleugnen, stellte mich als Pole vor, obwohl ich die polnische Sprache bestenfalls in sehr schlechter Umgangsform beherrschte und wollte mit denen, die mich trotz aller Bemühungen nie an ihrem „Deutschsein“ teilhaben ließen, nichts mehr zu tun haben. Bevor ich nirgends zugehörig sein konnte, wollte ich wenigstens „der Pole“ sein.
„Gottlob! durch meine Fenster bricht
Französisch heit’res Tageslicht;
Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen,
Und lächelt fort die deutschen Sorgen.“
Zur Selbstverleugnung kam Selbstbetrug. Denn auch zu der Clique aus Osteuropäern konnte ich nicht richtig gehören: Während sie sich auf Russisch oder Polnisch verständigen konnten, antwortete und sprach ich immer auf Deutsch. Die Akzeptanz, die ich allerdings erfuhr, besserte zum Teil meine Haltung zu Polen. Viele Qualitäten, die diese Nation und ihr Volk besitzen, wurden mir nach und nach klar. Ich lernte trotz der mir bekannten schrecklichen Geschichte, die wie ein Schatten auf Polen und Deutschland liegt, den polnischen Einfluss in meiner Familie schätzen.
Viele der damaligen Freunde gehören auch heute noch zu meinem Freundeskreis. Nicht zuletzt diese Bekanntschaften haben mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet. Auch heute noch sehen viele Menschen in mir nur „den Polen“. Im Gegensatz zu den meisten Deutschen weiß ich aber, was es heißt, sich nach einem Vaterland zu sehnen und nie richtig angenommen zu werden. Während viele auf die Frage, was deutsch sei, keine Antwort wissen und sich auf ihr Land und ihre Herkunft keinen Reim machen können, habe ich durch diese diffuse Sehnsucht ein klares Bild von meiner Heimat entwickelt. Wenn man mich „Pollacke“ nennt, weiß ich, was es heißt deutsch zu sein. Während das Deutsch-Sein in der heutigen Zeit immer stärker relativiert wird und für viele geradezu ein Makel ist wie für mich einst das Pole-Sein, erkenne ich das schöne und beneidenswerte am Deutsch-Sein.
Und an jedem Tag, an dem den Deutschen eingetrichtert wird, sie seien ein „Tätervolk“ oder hätten eine „ewige Schuld“ zu tragen, wird mir klarer, wie viel Gutes und Wertvolles die Deutschen vollbracht haben. Es ist die reiche Geschichte von fast 2000 Jahren, die mich immer wieder fasziniert. Es ist der deutsche Erfindergeist, der in den letzten Jahrhunderten weltbewegende wissenschaftliche und technische Entwicklungen hervorbrachte, die aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken sind. Es ist die deutsche Kunst die mich immer wieder beeindruckt. Es ist die deutsche Dichtung und Philosophie, die mich zum Nachdenken animiert und unser aller Leben prägt und verschönt. Es ist die deutsche Architektur, die mich staunen lässt, wenn ich mir die großen gotischen Kathedralen anschaue, oder die Musik, die mich bewegt und träumen lässt. Und bis dahin hab ich noch kein Wort über die Menschen selbst verloren, die zwar immer beeindruckt von der Gastfreundschaft fremder Länder sprechen, aber angesichts von Millionen Einwanderern wohl die besten Gastgeber in Europa sind!
Es sind die deutschen Tugenden, die immer stärker in Vergessenheit geraten, doch immer dann wieder relevant werden, wenn man im Urlaub merkt, dass die deutsche Sauberkeit doch recht angenehm ist. Oder wenn man merkt, wie wichtig eigentlich Pünktlichkeit im Leben ist. Denn wer wartet schon gerne? Und auch wenn diese Eigenschaft immer mehr als „pingelig“ belächelt wird, sind doch immer alle verblüfft und begeistert über eine ordentliche Wohnung.
Wer verbindet noch neben der Fußball WM oder EM Emotionen mit Deutschland? Solange nicht gerade Fanfeste gefeiert und die Deutschlandfahnen geschwungen werden, schämen sich viele ihrer nationalen Identität. Bestenfalls weichen sie aus und geben sich lokalpatriotisch, teilweise suchen viele sogar nach einem nichtdeutschen Vorfahren, einem zweifelhaften „Adelsprädikat“ um nicht zu der großen Masse „deutscher Kartoffeln“ zu gehören.
Wenn ich fast täglich, an der Frankfurter Festhalle vorbeifahre und die große, sich im Wind drehende deutsche Fahne sehe, schlägt mein Herz schneller und ich spüre ein Gefühl von tiefer Rührung und mystischer Verbundenheit. Was spüren die meisten anderen dabei? Bemerken sie überhaupt, dass dort auf dem Dach eine Fahne weht?
Ich kenne die Geschichte meines Landes, seine Höhen und Tiefen, aber ich lass mir nicht gerne etwas über mein Heimatland erzählen, was dieses verhöhnt. Ich respektiere andere Länder und ihre Kulturen und erwarte den gleichen Respekt auch für meine Heimat.
Schaue ich mir die Monumente christlicher Religion dieses Landes an, Kirchen, Pilgerorte und ihre Heiligen und berühmten Denker und Stifter, besuche den mitternächtlichen Ostergottesdienst, bei dem wie in einem gewaltigen Chor das Te Deum gesungen wird, dann bekomme ich eine Gänsehaut und denke an die über tausendjährige christliche Tradition in diesem Land, dass sich einst „Heiliges römisches Reich deutscher Nation“ nannte und Beschützer der Christenheit war.
Sehe ich einen Hollywood-Film, in dem deutsche Soldaten pauschal als fiese Nazischurken gezeigt werden, denke ich nicht zuerst an die „Tätergeneration“ und eine Armee von Kriegsverbrechern, sondern an tapfere Soldaten, die dachten, sie würden für eine gerechte Sache kämpfen, die ihr Leben gaben im Glauben an diese Nation, aber auch durch den Wahn von wenigen sinnlos geopfert wurden und sich bis heute für den Wahn von anderen opfern müssen.
„Denke ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht.“ war die Einleitung meiner kleinen Geschichte. Auch ich werde regelmäßig um den Schlaf gebracht, wenn ich sehe was aus diesem Deutschland - meinem Deutschland - gemacht wird. In dem alles mit den Füßen getreten wird, was dieses Land in seiner Geschichte hervorgebracht hat. In dem es fast schon ein Verbrechen ist, so zu denken wie ich es tue. In dem die Toten verhöhnt werden, die Kultur verschmäht und erniedrigt, die Geschichte reduziert wird auf eine 12-jährige Zeitspanne von Verirrung und verbrecherischer nationalsozialistischer Diktatur.
Wenn ich an das heutige Deutschland denke, denke ich an ein Land das seine Wurzeln verleugnet, seinen Charakter entstellt, sein Potential wegwirft und dessen politische „Elite“ das Volk belügt und betrügt. Das ist nicht mein Deutschland! Und das lässt mich zweifeln, ob ich denn wirklich „deutsch“ sein will, wenn das, was ich so bewundere und liebe, nicht mehr existieren soll oder schon nicht mehr existiert. Es scheint, als wäre das Deutschland, nach dem ich immer strebte, als wäre dieses Deutschsein nur ein Traum: Ein transzendentes, metaphysisches, nur noch in der Vergangenheit existierendes Deutschland, das unerreichbar ist und immer unerreichbarer zu werden droht.
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.
Es war ein Traum.
Das küßte mich auf deutsch und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum Wie gut es klang)
das Wort: „Ich liebe dich!“
Es war ein Traum.
Doch muss dieses Deutschland ein Traum bleiben? Oder kann es wie ein Phönix aus der Asche wieder emporsteigen? Wird man in der Zukunft nur noch in Erinnerungen an die Vergangenheit schwelgen und sich fast vergessene Merkmale dieser Kultur nur noch im Geschichtsbuch anschauen? Oder ist es möglich, dieses Deutschland zurückzuholen?
„Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt“ heißt nicht, dass wir uns über andere stellen. Sondern dass dieses Land mit seinen Werten und Traditionen, mit seinen Landschaften und seiner Geschichte ein hohes Gut ist, das uns so wichtig sein muss, um zu garantieren, dass die Generationen nach uns keine Identitätsprobleme haben müssen.
Wenn es etwas gibt, das ich an den Polen bewundere, dann den großen Freiheitsdrang und den Durchhaltewillen. Die Deutschen können von ihren östlichen Nachbarn vieles lernen. Im Jahre 1832 beim Hambacher Fest und auch schon zwei Jahre zuvor bei den polnischen Novemberaufständen gegen die russische Besatzung begeisterte die polnische Widerstandsbewegung die Deutschen, die die polnischen Ideale gerne für sich einnahmen. Philipp Jakob Siebenpfeiffer sagte bei seiner Eröffnungsrede zum Hambacher Fest:
„Es lebe das freie, das einige Deutschland! Hoch leben die Polen, der Deutschen Verbündete! Hoch leben die Franken, der Deutschen Brüder, die unsere Nationalität und unsere Selbständigkeit achten! Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört! Vaterland - Volkshoheit - Völkerbund hoch!“
Freiheit, Vaterland und Volkshoheit werden heutzutage immer mehr bedrängt. Viele Deutsche wünschen sich ebenso wie die Völker anderer europäischer Staaten, diese drei Begriffe wieder geltend zu machen, sind jedoch frustriert und verzweifeln, weil sie keine Hoffnung auf Besserung mehr haben. Doch noch ist Deutschland nicht verloren, ganz wie es in der polnischen Nationalhymne heißt:
„Noch ist Polen nicht verloren,
Solange wir leben.“





