„Erlöst und vernichtet in einem“
Eine Römer-Diskussion über den 8. Mai 1945
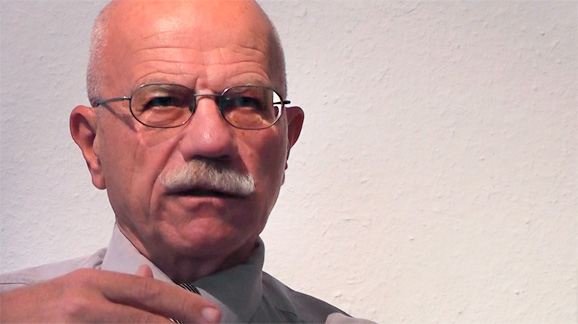
In der Stadtverordnetensitzung vom 7. Mai 2015 fand eine kontroverse Aussprache über zwei Resolutionen zum 70. Jahrestag des Endes des 2. Weltkriegs statt. Die Linkspartei betrachtet den 8. Mai 1945 als Tag der „Befreiung vom Hitler-Faschismus“, die Mehrheit der Stadtverordneten sieht das etwas differenzierter. Für die BFF-Fraktion redete der Stadtverordnete Wolfgang Hübner zu dem Thema. Wir dokumentieren seine Rede, die zu später Stunde erfolgte und in der Berichterstattung der Presse und sonstigen Medien mit keinem Wort erwähnt wurde.
_______________________________________________________________________________
Herr Vorsitzender,
meine Damen und Herren!
Ich gehöre zu den Jahrgängen der Nachkriegszeit, deren Eltern den Krieg und die ganze nationalsozialistische Zeit miterlebt und auch durchlitten haben. Am 8. Mai 1945 war mein Vater in amerikanischer Gefangenschaft in Norddeutschland, und meine Mutter saß hier in Frankfurt in einer zerstörten Stadt. Für beide war der Krieg bereits etwas früher zu Ende - für meinen Vater dadurch, dass er in Gefangenschaft genommen wurde, und für meine Mutter dadurch, dass die Amerikaner um diese Zeit Frankfurt schon längst besetzt hatten. Was haben meine Eltern damals gefühlt? Haben sie sich befreit gefühlt? Haben sie sich bedrückt gefühlt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater zu mir gesagt hat - als Kind wollte ich immer wissen, wie es im Krieg war -, es war gut, dass wir diesen Krieg nicht gewonnen haben.
(Beifall)
Diese Aussage habe ich für mein Leben mitgenommen. Es war nicht selbstverständlich, dass so etwas gesagt wurde. Wer wie ich in den 50er-Jahren in die Schule gegangen ist, der hat von seinen Klassenkameraden noch andere Töne gehört. Auch deren Väter haben darüber geredet und erzählt. Dabei kamen ganz andere Töne heraus. Es ist für diejenigen, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben - es waren viele Millionen -, unbenommen und unbestritten, dass es auf jeden Fall ein Tag der Befreiung war.
(Beifall)
Insofern ist es für diejenigen, die aus den KZs befreit wurden, die auf andere Weise in Freiheit gekommen sind, oder aber auch für die Völker, die von Nazi-Deutschland besetzt waren, eine Befreiung - ganz klar. Diese Menschen haben allen Grund, diesen Tag als Tag der Befreiung anzusehen und ihn auch entsprechend zu feiern.
(Beifall)
Für die Sowjetunion, die den größten Blutzoll gezahlt hat und zahlen musste, ist der Tag des Kriegsendes der 9. Mai und nicht der 8. Mai: Die Russen werden an diesem Tag feiern. Ich weiß durch Kontakte mit Menschen, die von dort kommen und dort leben, dass das eine echte Feier ist. Das war schon in der Sowjetunion eine echte Feier, die nicht befohlen wurde. So ist es auch jetzt noch. Es ist absolut verständlich. Wie sieht aber die Situation bei uns aus?
Ich glaube, für Deutschland und für die Deutschen ist das auch 70 Jahre nach diesem 8. Mai oder 9. Mai ein schwieriger Tag. Dieser Tag ist nicht allein mit dem Begriff der Befreiung zu erfassen. Er ist auch damit zu erfassen, aber nicht nur. Sie haben den Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zitiert. Es gab aber noch einen anderen Bundespräsidenten, nämlich Theodor Heuss. Theodor Heuss hat diese Zeit sehr bewusst miterlebt. Theodor Heuss hat in einer seiner Reden auch versucht, diese Situation, die am 8. Mai 1945 entstanden ist, und diese Widersprüchlichkeit, die in ihr lag, zu benennen. Theodor Heuss hat gesagt, dass wir „erlöst und vernichtet in einem gewesen sind“.
Ich glaube, dass das, was Theodor Heuss damals gesagt hat, sehr nah an das Gefühl herankommt, mit dem Deutsche diesen Tag damals betrachtet haben, und den nötigen Respekt vor denen mitbringt, die den Tag damals miterlebt haben.
(Beifall)
Deswegen ist mit diesem Wort „Befreiung“ nicht die Komplexität dieses Tages und dieses Ereignisses erfasst. Insofern liegen Sie dann auch nicht richtig. Das ist eine Fälschung. Man sollte sich die Dinge nicht zusammenfälschen. Für Deutschland und für die Deutschen - ich sage es noch einmal - ist der 8. Mai ein schwieriger Tag. Das war so und das bleibt auch so, gerade heute.
(Zurufe)
Ich weiß nicht, was daran lächerlich ist. Heute habe ich, wie es der Zufall möchte, etwas gelesen, was ein Russe über diese Zeit berichtet. Er hat es auf einer russischen Website veröffentlicht. Ich lese Ihnen das vor, weil mich dieser Text erschüttert hat, was nicht so oft passiert.
Der Text lautet: „Die Familie meines Vaters war recht groß. Er hatte sechs Brüder, von denen fünf gefallen sind. Eine Katastrophe für die Familie. Auch Verwandte meiner Mutter sind umgekommen. Ich selbst war ein spätgeborenes Kind. Meine Mutter war 41 Jahre alt, als sie mich zur Welt brachte. Aber es gab ja keine einzige Familie, in der nicht jemand gefallen ist. Es gab viel Kummer, viel Unglück, Tragödien. Was verwunderlich ist: Sie empfanden keinen Hass gegenüber dem Feind. Ich kann das, ehrlich gesagt, bis heute nicht ganz begreifen. Meine Mutter war überhaupt ein sehr weichherziger, gütiger Mensch. Sie sagte: ‚Wie soll man diese Soldaten hassen? Es waren einfache Leute und sie sind auch im Krieg gefallen.‘ Das ist erstaunlich. Wir wurden von sowjetischen Büchern und Filmen erzogen. Und wir hassten. Aber bei ihr war das aus irgendeinem Grund überhaupt nicht so. Ich habe mir ihre Worte eingeprägt, was will man denn von ihnen? Sie waren fleißige Arbeiter wie wir auch. Man hat sie einfach an die Front getrieben! Von Kindheit an erinnere ich mich an diese Worte.“
Ich sage Ihnen, wer das geschrieben hat: Wladimir Putin.
(Zurufe)
Wladimir Putin hat das geschrieben. Ich habe es extra nach den Reden von Frau Ditfurth und der Linkspartei zitiert, um an diesem Tag einen anderen Ton anzuschlagen, einen Ton, den ich bewundere, vor dem ich großen Respekt habe und der zu diesem besonderen Tag und zu diesem besonderen Ereignis besser passt als Reden über Resolutionen und sonstiges. Ansonsten nehmen wir diese Resolution, die die Koalition des alten Viererbündnisses präsentiert hat, auch an.
Danke schön, meine Damen und Herren!
(Beifall)





